Kinder des Schreckens – Was bedeutet ein traumatisches Erlebnis während der Schwangerschaft für das Kind?
Krieg, Naturkatastrophen, Anschläge - die Nachrichten sind tagtäglich voll von schrecklichen Ereignissen. Das Stichwort Traumatisierung ist spätestens seit der Zuwanderungsthematik der letzten Jahre ein Begriff. Besonders schlimm ist es, wenn Kinder betroffen sind. Doch wie steht es um Kinder, die die Ereignisse im Bauch ihrer schwangeren Mutter miterlebt haben? Auch wenn diese zum Zeitpunkt des Geschehens noch nicht einmal geboren waren, ist es möglich, dass sie später unter den Folgen leiden. Denn auf biologischer Ebene finden Vorgänge statt, die dazu führen, dass auch das ungeborene Kind von dem beeinflusst wird, was es im Bauch der Mutter miterlebt hat.
Wenn die junge Mutter an den Tag zurückdenkt, an dem sie auf dem Nachhauseweg Zeugin davon wurde, wie das Haus ihrer Familie durch eine Explosion zerstört wurde, kann sie auch jetzt noch, Monate später, den Knall und die Sirenen hören. Die Erinnerungen an die folgenden Stunden, Tage und Wochen sind verschwommen, sie erinnert sich nur vage daran, wie sie ihre Heimat Syrien hinter sich ließ. Weg von dem zerstörten Haus, weg aus ihrer Heimatstadt. Doch sie hat es bis nach Deutschland geschafft - hochschwanger. Jetzt schläft ihr kleiner Sohn auf ihrem Arm. Scheinbar ist alles gut ausgegangen. Doch was die junge Frau erlebt hat, hat Spuren hinterlassen.
Die Frau, die hier beschrieben wird, gibt es nicht. Aber es könnte sie geben. Denn ihre Erlebnisse stehen beispielhaft für alle Mütter, die während ihrer Schwangerschaft Schlimmes erleben mussten. Die Folgen, die solche Geschichten für diejenigen haben können, die sie erleben, sind weitgehend bekannt, doch die junge Mutter hat die traumatischen Ereignisse nicht alleine erlebt: Ihr ungeborenes Kind war die ganze Zeit dabei. Das Kind hat von den Geschehnissen aber nichts mitbekommen. Oder?
Dass Stress in der Schwangerschaft nicht gut für das ungeborene Kind ist und vermieden werden sollte, gilt als wissenschaftlich gesichert (z. B. Beijers et al., 2014; King et al., 2012). Genauso bekannt ist aber auch, dass dies nicht immer möglich ist und sich wahrscheinlich jede schwangere Frau hin und wieder gestresst fühlt. Das ist auch nicht weiter schlimm, solange es keine extremen Ausmaße annimmt. Doch traumatische Erlebnisse, wie die oben beschriebene fiktive Geschichte der syrischen Mutter, die so oder so ähnlich wahrscheinlich einer großen Zahl an Frauen widerfahren ist, stellen eine extreme Stressbelastung dar. Dies hat nicht nur weitreichende Folgen für die werdenden Mütter, sondern wirkt sich auch auf die ungeborenen Kinder aus (z. B. Ramo-Fernández et al., 2015). Um zu verstehen, warum, ist ein Überblick über die körperlichen Reaktionen auf Stress hilfreich.
In einer Stresssituation laufen bestimmte Prozesse ab, die den Körper darauf vorbereiten, eine Bedrohung bewältigen zu können. Im evolutionären Sinne bedeutet das Kampf oder Flucht. Es werden Energiereserven bereitgestellt, der Herzschlag wird schneller, der Blutdruck steigt und verschiedene Hormone werden ausgeschüttet. Die größte Bedeutung dabei hat das Stresshormon
Cortisol, das durch die Aktivierung der sogenannten
Stressachse, also der Reaktionskette vom Gehirn zum Körper, in der Nebennierenrinde vermehrt ausgeschüttet wird. Im Normalzustand ist
Cortisol an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt. In Stresssituationen wird durch die vermehrte Cortisolproduktion unter anderem die Aktivität des Immunsystems unterdrückt und das Schmerzempfinden herabsetzt. Extreme Stresssituationen, wie durch ein
Trauma bedingt, haben somit eine stark erhöhte Cortisolkonzentration im Blut der Mutter zur Folge. Ein Fötus ist durch die Plazenta eng mit dem Stoffwechsel der Mutter verbunden. Deshalb wirkt sich eine erhöhte Cortisolproduktion der Mutter auch auf das Kind aus, was dann selbst ebenfalls mehr
Cortisol produziert und somit die Stresssituation auf biologischer Ebene miterlebt. Dieser veränderte Cortisolhaushalt wird als einer der Hauptmechanismen angesehen, über den sich eine Traumatisierung der Mutter in der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind auswirkt. Eigentlich besitzt die Plazenta einen Schutzmechanismus, der das Kind vor zu viel
Cortisol schützen soll. Wenn die Konzentration aber zu stark oder über einen zu langen Zeitraum erhöht ist, wird dieser Schutz unwirksam. Ist der Fötus zu viel
Cortisol ausgesetzt, kann dies negative Folgen für Entwicklung und Gesundheit haben (Beijers et al., 2014). Zum Beispiel werden ein geringeres Geburtsgewicht (Xiong et al., 2008), ein erhöhtes Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und bestimmte psychische Störungen sowie Beeinträchtigungen des Immunsystems (King et al., 2012) mit einem erhöhten Cortisolspiegel vor der Geburt assoziiert.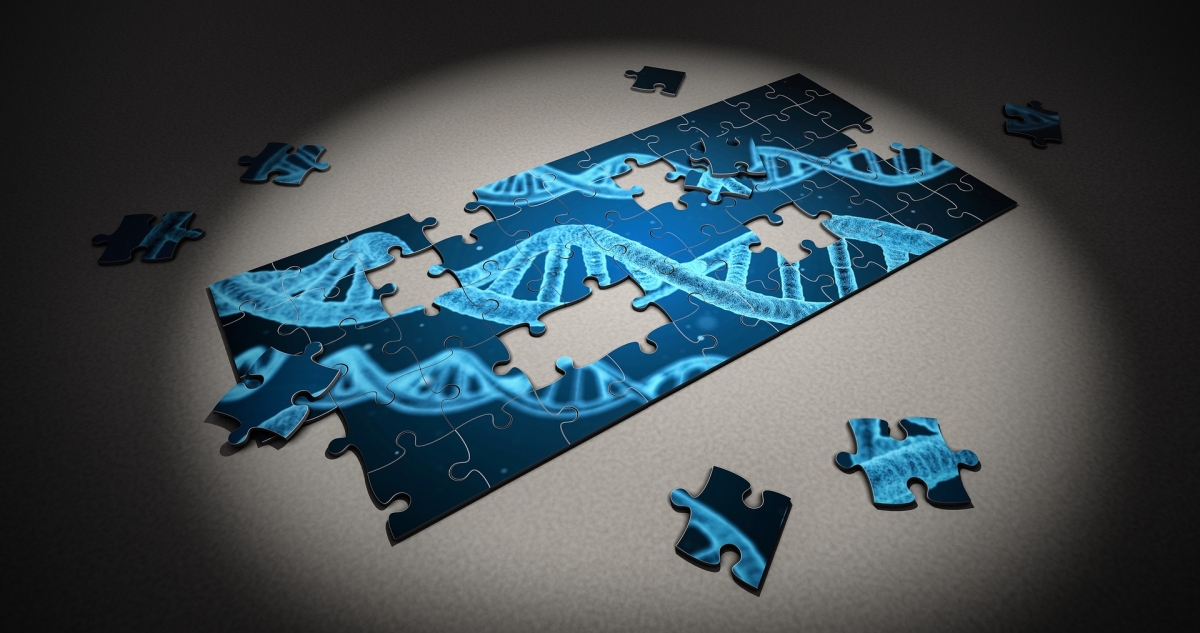 Bild 3: Veränderbares Erbgut
Bild 3: Veränderbares Erbgut
Auf einer ganz grundlegenden Ebene des Körpers spielt sich ein anderer Mechanismus ab, über den sich Umwelteinflüsse in der Schwangerschaft auf ungeborene Kinder auswirken können, die sogenannte Epigenetik. Unsere Gene – das Erbgut – legen eine Art Bauplan fest, die Eigenschaften eines Organismus. Lange ging man davon aus, dass diese Informationen unveränderbar sind. Über epigenetische Mechanismen wird aber durch den Einfluss äußerer Umstände bestimmt, welche Gene zum Beispiel aktiviert oder ausgeschaltet sind. Es verändert sich also nicht direkt der Genotyp bzw. das Erbgut, epigenetische Mechanismen wirken sich jedoch auf Merkmale des Organismus, den Phänotyp, aus (Lester et al., 2016). Solche epigenetischen Veränderungen können im Laufe des Lebens geschehen, aber auch bereits vor der Geburt im Mutterleib. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass Stress, also im Extremfall traumatische Erfahrungen der Mutter während der Schwangerschaft, epigenetische Veränderungen beim ungeborenen Kind nach sich ziehen, um es so auf die augenscheinlich suboptimale Umwelt nach der Geburt vorzubereiten (Ramo-Fernández et al., 2015). Es wird vermutet, dass dies der Mechanismus ist, der hinter dem genannten Einfluss des Cortisols steckt. Die erhöhte Cortisolkonzentration im Blut der Mutter und beim ungeborenen Kind selbst stellt also wahrscheinlich den zentralen Umwelteinfluss dar, der zu epigenetischen Veränderungen beim Kind führt. Die Veränderung findet zum Beispiel auf einem Gen statt, das die Rezeptoren codiert, an die unter anderem Cortisol bindet. Diese Rezeptoren sind wichtig, damit die körperliche Stressreaktion durch negatives Feedback wieder beendet wird. Bei Babys, die pränatalem Stress ausgesetzt waren, ist dieses Gen durch die epigenetischen Veränderungen weniger aktiv. Dadurch dauert die körperliche Stressreaktion länger an (Ramo-Fernández et al., 2015). Die Auswirkungen traumatischer Situationen können demnach nicht nur kurz- sondern auch langfristig sein (Golub et al., 2016).
Doch wie können sich die Folgen eines solchen Traumas in der Schwangerschaft konkret auf das spätere Leben des Kindes auswirken? Die Forschung steht hier vor diversen Problemen. Um einen kausalen Effekt, also Ursache und Wirkung, festzustellen, sind experimentelle Studien notwendig. Dabei muss der als Ursache vermutete Einflussfaktor veränderbar sein und die Studienteilnehmer zufällig verschiedenen Bedingungen zugeordnet werden. In diesem Fall wäre die verursachende Variable das Trauma während der Schwangerschaft und die verschiedenen Bedingungen „Trauma“ und „kein Trauma“. Die Problematik liegt auf der Hand: Es ist natürlich ethisch nicht vertretbar, schwangere Frauen mutwillig zu traumatisieren. Die Forschung beschränkt sich somit auf bereits aufgetretene Traumata, die allerdings schwer zu erfassen sind und sich stark unterscheiden. Außerdem kann die Traumatisierung oft auf keinen genauen Zeitpunkt zurückgeführt werden, wenn zum Beispiel im Kontext von Krieg oder Flucht die Ereignisse wiederholt auftreten oder über längere Zeit andauern. Die Forschung greift daher zum einen auf Tierversuche, zum Beispiel mit Ratten und Mäusen, zurück. Zum anderen sind Ereignisse, die viele Menschen gleichzeitig zu einem bekannten Zeitpunkt betreffen, gut geeignet, um das Thema zu erforschen (Engel et al., 2005). Hierzu zählen zum Beispiel Naturkatastrophen. Die Forschungsgruppe um Suzanne King untersuchte im Rahmen des Project Ice Storm Betroffene eines Eissturms im Jahr 1998 im kanadischen Québec (King et al., 2012). Darauf aufbauend führten sie außerdem die Iowa Flood Studie und QF2011 mit Betroffenen der Überflutungen im mittleren Westen der USA 2008 und im australischen Queensland 2011 durch. An diesen Betroffenen untersuchten sie, wie sich der extreme Stress durch die Naturkatastrophen auf Kinder von Müttern auswirkte, die zum jeweiligen Zeitpunkt schwanger waren (King et al., 2015; Yong Ping et al., 2015). Weitere Ereignisse, die im Rahmen dieser Thematik untersucht wurden, sind der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 (Engel et al., 2005), der Hurricane Katrina im Südosten der USA im Jahr 2005 (Xiong et al., 2008) und das Atomunglück von Tschernobyl 1986 (Huizink et al., 2007).
 Bild 4: KriegAuch wenn die Forschung vor Herausforderungen steht, wenn es darum geht herauszufinden, welche Folgen ein
Trauma während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind haben kann, gibt es bereits einige Ergebnisse. Die Folgen beziehen sich auf Gesundheit und Entwicklung des Kindes sowohl vor der Geburt, als auch im langfristig im späteren Leben. Ein gemeinsames Ergebnis der Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist das verminderte Geburtsgewicht und die geringere Körpergröße. Babys, deren Mütter während der Schwangerschaft ein
Trauma erlebt haben, haben bei der Geburt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein geringeres Geburtsgewicht und sind kleiner als Babys, deren Mütter keiner extremen Stressbelastung ausgesetzt waren. Xiong und KollegInnen (2008), die sich in ihrer Studie mit dem Hurricane Katrina beschäftigten, berichteten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby bei der Geburt unter 2500 Gramm wog, dreifach erhöht war, wenn die Mutter während der Schwangerschaft der Stressbelastung durch den Hurricane ausgesetzt war. ForscherInnen erklären dies damit, dass durch die Veränderungen im Körper der Mutter, wie zum Beispiel erhöhte Konzentration des Stresshormons
Cortisol, das Umfeld in der Gebärmutter für das Baby nicht mehr optimal ist und es dadurch weniger gut wachsen kann (Golub et al., 2016). Auch die Entwicklung des Gehirns kann durch Traumata in der Schwangerschaft beeinflusst werden. Bereiche des Gehirns, die bei den untersuchten Babys weniger gut entwickelt waren, sind vor allem der präfrontale
Cortex, der
Hippocampus und die
Amygdala. Diese Bereiche sind zuständig für die Steuerung des Verhaltens, für
Emotionsregulation,
Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Angstempfinden und auch die Regulation der körperlichen Stressreaktion (Beijers et al., 2014). Außerdem haben Babys, deren Mütter ein
Trauma erlebt haben, ein erhöhtes Risiko, zu früh geboren zu werden. Dies wird auch durch die erhöhte Cortisolkonzentration erklärt, die dazu führen kann, dass die Geburt früher eintritt.
Cortisol spielt auch in normal verlaufenden Schwangerschaften eine große Rolle. Gegen Ende der Schwangerschaft wird vermehrt
Cortisol produziert und damit eine Art biologische Kettenreaktion ausgelöst, die schlussendlich zur Geburt führt (Engel et al., 2005).
Bild 4: KriegAuch wenn die Forschung vor Herausforderungen steht, wenn es darum geht herauszufinden, welche Folgen ein
Trauma während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind haben kann, gibt es bereits einige Ergebnisse. Die Folgen beziehen sich auf Gesundheit und Entwicklung des Kindes sowohl vor der Geburt, als auch im langfristig im späteren Leben. Ein gemeinsames Ergebnis der Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist das verminderte Geburtsgewicht und die geringere Körpergröße. Babys, deren Mütter während der Schwangerschaft ein
Trauma erlebt haben, haben bei der Geburt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein geringeres Geburtsgewicht und sind kleiner als Babys, deren Mütter keiner extremen Stressbelastung ausgesetzt waren. Xiong und KollegInnen (2008), die sich in ihrer Studie mit dem Hurricane Katrina beschäftigten, berichteten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby bei der Geburt unter 2500 Gramm wog, dreifach erhöht war, wenn die Mutter während der Schwangerschaft der Stressbelastung durch den Hurricane ausgesetzt war. ForscherInnen erklären dies damit, dass durch die Veränderungen im Körper der Mutter, wie zum Beispiel erhöhte Konzentration des Stresshormons
Cortisol, das Umfeld in der Gebärmutter für das Baby nicht mehr optimal ist und es dadurch weniger gut wachsen kann (Golub et al., 2016). Auch die Entwicklung des Gehirns kann durch Traumata in der Schwangerschaft beeinflusst werden. Bereiche des Gehirns, die bei den untersuchten Babys weniger gut entwickelt waren, sind vor allem der präfrontale
Cortex, der
Hippocampus und die
Amygdala. Diese Bereiche sind zuständig für die Steuerung des Verhaltens, für
Emotionsregulation,
Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Angstempfinden und auch die Regulation der körperlichen Stressreaktion (Beijers et al., 2014). Außerdem haben Babys, deren Mütter ein
Trauma erlebt haben, ein erhöhtes Risiko, zu früh geboren zu werden. Dies wird auch durch die erhöhte Cortisolkonzentration erklärt, die dazu führen kann, dass die Geburt früher eintritt.
Cortisol spielt auch in normal verlaufenden Schwangerschaften eine große Rolle. Gegen Ende der Schwangerschaft wird vermehrt
Cortisol produziert und damit eine Art biologische Kettenreaktion ausgelöst, die schlussendlich zur Geburt führt (Engel et al., 2005).
In manchen der Studien wurden die Kinder nicht nur direkt nach der Geburt untersucht, sondern auch noch einige Jahre später, um mögliche Langzeitfolgen zu erforschen. Dabei zeigte sich, dass Traumata in der Schwangerschaft das Risiko für einige psychische und körperliche Krankheiten erhöht. Vor allem Stoffwechselveränderungen wie Diabetes und Übergewicht scheinen öfter aufzutreten. Ein Erklärungsversuch besteht darin, dass der Organismus durch die weniger optimalen Bedingungen in der Gebärmutter darauf vorbereitet wird, Energiereserven möglichst gut zu verwerten und zu speichern und Stoffwechselvorgänge dementsprechend anpasst (Golub et al., 2016; King et al., 2012). Auch die Entwicklung des Immunsystems der Kinder wird durch die pränatale Stressbelastung beeinflusst. Einige Funktionen sind dadurch stärker, und andere schwächer ausgeprägt, als bei Kindern ohne
Trauma in der Schwangerschaft. Beispielsweise scheint das Risiko für Asthma und Allergien erhöht zu sein. Die kann man durch ein überaktives Immunsystem erklären, das bereits vor der Geburt darauf vorbereitet wurde, Gefahren möglichst effektiv zu bekämpfen und somit dazu neigt, überzureagieren (King et al., 2012). In der sprachlichen und geistigen Entwicklung der Kinder kann es zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen, die denen von Frühchen ähneln. Es wird angenommen, dass dies an Defiziten in der Gehirnentwicklung liegt (King et al., 2012). Außerdem leiden Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft ein
Trauma erlebten, später häufiger an
ADHS, affektiven psychischen Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, und Verhaltensauffälligkeiten. Auch hier kann die veränderte Gehirnentwicklung eine Erklärung liefern, bei der möglicherweise die Aufnahme bestimmter Botenstoffe im Gehirn schlechter funktioniert (Engel et al., 2005; Huizink et al., 2007; King et al., 2012). Da die körperliche Stressreaktion der Mutter eine sehr wichtige Rolle spielt, liegt es nahe, dass die Stressreaktion auch bei den Kindern verändert sein könnte. Eine Studie, die genau dies untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass vor allem Mädchen stärker auf Stresssituationen reagieren, also mehr
Cortisol ausschütten (Yong Ping et al., 2015). Bild 5: Mutter mit Baby
Bild 5: Mutter mit Baby
Erlebnisse, wie sie der jungen Mutter aus dem Eingangsbeispiel widerfahren sind, können in der Schwangerschaft also durchaus großen Einfluss auf das ungeborene Kind haben. Auch wenn dieses die Ereignisse nicht bewusst miterlebt, bekommt es auf biologischer Ebene eine Menge mit von dem, was die Mutter durchmacht. Die Folgen können langfristig gesundheitlich und psychisch zu spüren sein und entstehen durch den körperlichen Ausnahmezustand, in dem sich die Mutter bei und nach einem traumatischen Erlebnis befindet. Das sich entwickelnde Kind befindet sich schon vor der Geburt in einer Umgebung, die nicht so optimal für die Entwicklung ist, wie sie ohne die extreme Stressbelastung wäre. Dadurch wird der Organismus darauf vorbereitet, sich auch nach der Geburt in einer potentiell gefährlichen Umgebung zu beweisen, was bestimmte Anpassungen mit sich bringt. Da die Umgebung letztendlich nicht in diesem Sinne gefährlich ist, sind diese Veränderungen eher Fehlanpassungen und haben im Endeffekt negative Folgen.
Wichtig zu beachten ist allerdings, dass trotz der Vielzahl möglicher Auswirkungen nicht jede in jedem Fall auftritt. Genauso wie traumatische Erlebnisse individuell sind, sind auch die psychischen und biologischen Reaktionen darauf individuell und somit auch die Auswirkungen auf ein ungeborenes Kind. Die Befunde aus den Studien beschreiben immer eine Gruppe an Personen und nie einen Einzelfall. Neben dem Trauma an sich spielen noch viele weitere Dinge eine Rolle. So gibt es Unterschiede je nach Zeitpunkt in der Schwangerschaft, zu dem das Trauma erlebt wurde, auch das Geschlecht des Kindes spielt eine Rolle. Wie anhand der Probleme, vor denen die Forschung zu diesem Thema steht, bereits deutlich wurde, liefern die Studien zwar erste Anhaltspunkte, aber keinesfalls endgültige Fakten und auch die Wirkmechanismen sind bei Weitem nicht abschließend erforscht. Man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, dass nicht nur die biologischen Veränderungen während der Schwangerschaft Auswirkungen auf das Kind haben können, sondern auch jegliche Erfahrungen des Kindes nach der Geburt. Ein Trauma kann für die Mutter lange belastend sein, was sich auch im Umgang mit dem Kind äußern kann (Golub et al., 2016). In den Studien, die langfristige Effekte betrachten, lassen sich diese Einflüsse kaum von den Faktoren trennen, die wirklich während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind eingewirkt haben. Außerdem gibt es neben Risikofaktoren auch immer schützende Faktoren, welche die Folgen negativer Ereignisse abmildern können. Es gibt also neben Kindern, die mehrere Folgeerscheinungen zeigen, höchstwahrscheinlich auch Kinder, die überhaupt keine Folgen davontragen.
Da Traumatisierung (nicht nur) während der Schwangerschaft hohe thematische Relevanz besitzt, sollte man trotz allem berücksichtigen, dass die Folgen sehr weitreichend sein können, nicht nur für die direkt Betroffenen. Wenn nun der kleine Sohn der syrischen Mutter in der Schule auffällig werden sollte, könnte es einen Gedanken wert sein, bei der Suche nach Gründen die Erlebnisse der Mutter während der Schwangerschaft mit in Betracht zu ziehen und besonders aufmerksam zu sein, um bestimmte Probleme angehen zu können, bevor sie zu schwer wiegen.
Literaturverzeichnis
Beijers, R., Buitelaar, J. K., & de Weerth, C. (2014). Mechanisms underlying the effects of prenatal psychosocial stress on child outcomes: Beyond the HPA axis. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 23, 943–956. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0566-3
Engel, S. M., Berkowitz, G. S., Wolff, M. S., & Yehuda, R. (2005). Psychological trauma associated with the World Trade Center attacks and its effect on pregnancy outcome. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 19, 334–341.
Golub, Y., Canneva, F., Funke, R., Frey, S., Distler, J., von Hörsten, S., Freitag, C. M., Kratz, O., Moll, G. H., & Solati, J. (2016). Effects of in utero environment and maternal behavior on neuroendocrine and behavioral alterations in a mouse model of prenatal Trauma. Developmental Neurobiology, 76, 1254–1265. https://doi.org/10.1002/dneu.22387
Huizink, A. C., Dick, D. M., Sihvola, E., Pulkkinen, L., Rose, R. J., & Kaprio, J. (2007). Chernobyl exposure as stressor during pregnancy and behaviour in adolescent offspring. Acta Psychiatrica Scandinavica, 116, 438–446. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2007.01050.x
King, S., Dancause, K., Turcotte-Tremblay, A.-M., Veru, F., & Laplante, D. P. (2012). Using natural disasters to study the effects of prenatal maternal stress on child health and development. Birth Defects Research, 96, 273–288. https://doi.org/10.1002/bdrc.21026
King, S., Kildea, S., Austin, M.-P., Brunet, A., Cobham, V. E., Dawson, P. A., Harris, M., Hurrion, E. M., Laplante, D. P., McDermott, B. M., McIntyre, H. D., O’Hara, M. W., Schmitz, N., Stapleton, H., Tracy, S. K., Vaillancourt, C., Dancause, K. N., Kruske, S., Reilly, N., … Yong Ping, E. (2015). QF2011: A protocol to study the effects of the Queensland flood on pregnant women, their pregnancies, and their children’s early development. BMC Pregnancy & Childbirth, 15(109). https://doi.org/10.1186/s12884-015-0539-7
Lester, B. M., Conradt, E., & Marsit, C. (2016). Introduction to the special section on epigenetics. Child Development, 87(1), 29–37. https://doi.org/10.1111/cdev.12489
Ramo-Fernández, L., Schneider, A., Wilker, S., & Kolassa, I.-T. (2015). Epigenetic alterations associated with war trauma and childhood maltreatment. Behavioral Sciences and the Laq, 33, 701–721. https://doi.org/10.1002/bsl
Xiong, X., Harville, E. W., Mattison, D. R., Elkind-Hirsch, K., Pridjian, G., & Buekens, P. (2008). Exposure to hurricane Katrina, Post-traumatic Stress Disorder and birth outcomes. The American Journal of the Medical Sciences, 336(2), 111–115. https://doi.org/10.1097/MAJ.0b013e318180f21c
Yong Ping, E., Laplante, D. P., Elgbeili, G., Hillerer, K. M., Brunet, A., Hara, M. W. O., & King, S. (2015). Prenatal maternal stress predicts stress reactivity at 2 ½ years of age: The Iowa Flood Study. Psychoneuroendocrinology, 56, 62–78. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2015.02.015
Bildquellen
Bild 1 (Übersichtsanzeige): milli_lu via Pixabay (https://pixabay.com/de/photos/schwanger-m%C3%A4dchen-magen-gebrochen-120..., Lizenz: https://pixabay.com/de/service/license/).
Bild 2: Fotorech via Pixabay (https://pixabay.com/de/photos/schwanger-schwangere-frau-m-mutter-2640994/, Lizenz: https://pixabay.com/de/service/license/).
Bild 3: qimono via Pixabay (https://pixabay.com/de/photos/puzzle-dna-forschung-genetische-2500333/, Lizenz: https://pixabay.com/de/service/license/).
Bild 4: Alexas_Fotos via Pixabay (https://pixabay.com/de/illustrations/syrien-krieg-opfer-fl%C3%BCchtlinge..., Lizenz: https://pixabay.com/de/service/license/).
Bild 5: blankita_ua via Pixabay (https://pixabay.com/de/photos/baby-neugeborene-kinder-4100420/; Lizenz: https://pixabay.com/de/service/license/).


