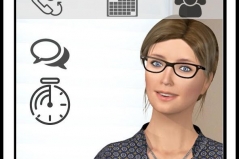Achtsamkeit statt Pillen – auch während der Schwangerschaft
Achtsamkeit statt Pillen – auch während der Schwangerschaft
Die ganze Welt redet von Achtsamkeit. Doch was genau soll das sein? Und kann Achtsamkeit vielleicht auch Schwangeren helfen, besser mit Stress umzugehen? / mehr
„Mein Herz schlägt schneller als deins“ – Entscheidet der Herzschlag über die Entwicklung eines Kindes?

Schlagwörter:
Herzrate / Kindes-Entwicklung / Herzratenvariabilität / Geburt
„Mein Herz schlägt schneller als deins“ – Entscheidet der Herzschlag über die Entwicklung eines Kindes?
Wie wird sich mein Kind entwickeln? Diese Frage beschäftigt wahrscheinlich alle werdenden Eltern. Doch gibt es Anhaltspunkte, anhand derer man die Entwicklung bereits während der Schwangerschaft vorhersagen kann? Mit dem Herzschlag scheint dies zumindest teilweise möglich zu sein.
/ mehrSpieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im Online-Land?

Schlagwörter:
Soziale Medien / Sozialer Vergleich / Instagram / Zufriedenheit
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im Online-Land?
Menschen vergleichen sich mit anderen, um so zu einer Einordnung der eigenen Fähigkeiten und Meinungen zu gelangen. Wie äußert sich dieses Phänomen des sozialen Vergleichs in Zeiten der sozialen Medien?
/ mehrTherapeutInnen der Zukunft? Wie virtuelle Figuren Selbstoffenbarung fördern
TherapeutInnen der Zukunft? Wie virtuelle Figuren Selbstoffenbarung fördern
Virtuelle Figuren mit sozialen Fähigkeiten bieten als innovative Schnittstelle in der Interaktion zwischen Mensch und Computer eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im therapeutischen Kontext – z.B. bei der Burnout-Reintegration. Könnten sie in Zukunft menschliche TherapeutInnen ersetzen?
/ mehrMitgehangen – mitgefangen? Wie sich Suchtprobleme auf Angehörige auswirken

Schlagwörter:
Angehörige / Sucht / Hilfsangebote / Stigmatisierung
Mitgehangen – mitgefangen? Wie sich Suchtprobleme auf Angehörige auswirken
Haben Sie schon einmal bei der Begrüßung Ihres Partners die Sorge gehabt, dass dieser wieder nach Alkohol riecht? Oder haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie das Zimmer Ihres Kindes heimlich nach Tütchen mit Cannabis durchsuchen? Wenn Sie sich in diesen Beschreibungen wiederfinden, dann gehören vielleicht auch Sie zu den mehreren Millionen Menschen in Deutschland, die als Angehörige vom problematischen Substanzkonsum eines Familienmitglieds mitbetroffen sind. Möglicherweise haben Sie ähnliche Geschichten auch schon einmal im Freundes- oder Bekanntenkreis gehört und sich die Frage gestellt, welche Auswirkungen eine Suchtproblematik eigentlich auf die Familien der Betroffenen hat und wie diese damit umgehen können. Der folgende Artikel stellt den aktuellen Forschungsstand zur Lebenssituation und zu Unterstützungsbedarfen bei diesen Angehörigen dar. / mehr
Wie Sie mehr von Ihrem „Ersten Mal“ haben

Schlagwörter:
Produkterleben / Genuss / Zufriedenheit
Wie Sie mehr von Ihrem „Ersten Mal“ haben
Es wird nie wieder so wie beim „Ersten Mal“. Diese Erfahrung machen wir bei vielen Erlebnissen. Und daher sind wir – um möglichst frischen und unverbrauchten Genuss zu erleben – immer wieder auf der Suche nach Variation. Dabei gibt es sehr einfache Regeln, wie man der Freude am „Ersten Mal“ Dauer verleihen kann. / mehr
Lügen auf kurzen Beinen – wie sich prosoziales Lügen in der Kindheit entwickelt

Schlagwörter:
Kinder / Gruppenzugehörigkeit / Lügen
Lügen auf kurzen Beinen – wie sich prosoziales Lügen in der Kindheit entwickelt
Eine Freundin spielte neulich mit dem Gedanken, ihrer 11-jährigen Nichte Frida nicht die herzensgewünschte neue Puppe zu schenken, sondern eine Holzeisenbahn – weil Puppen kann ja jeder. Doch dann kamen ihr Zweifel: Wie würde Frida reagieren, wenn sie voller freudiger Puppenerwartung das Geschenkpapier aufreißt und das Drama realisiert? Forscherinnen der Universität Wisconsin-Madison und der Radboud Universität in Nijmegen würden sagen: es kommt ganz darauf an, welches T-Shirt der Schenkende anhat… / mehr
Promovieren in Deutschland – Bestenauslese oder Resterampe?

Schlagwörter:
Wissenschaftspolitik / Wissenschaftsförderung / Gerechtigkeit
Promovieren in Deutschland – Bestenauslese oder Resterampe?
Würden Sie in ein Unternehmen einsteigen, das nur 26 Stunden bezahlt, obwohl Sie 40 Stunden arbeiten? Wenn Sie in Deutschland promovieren wollen, ist dieser Deal meist der Bestfall – eine Problemdarstellung. / mehr
Gelingende Integration: Der Einfluss von Persönlichkeitsaspekten Geflüchteter
Gelingende Integration: Der Einfluss von Persönlichkeitsaspekten Geflüchteter
Die gesellschaftliche Debatte darüber, wie die Integration der vielen Geflüchteten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, gut gelingen kann, ist immer noch hoch aktuell und wird weiterhin intensiv geführt. / mehr
Ich hab‘ recht! Nein, Du hast recht! – Wie Kinder ihre Meinung ändern

Schlagwörter:
Wissen; Kindermeinung; Sicherheit; Überzeugung
Ich hab‘ recht! Nein, Du hast recht! – Wie Kinder ihre Meinung ändern
Schon manch einer von uns erlebt, wie ein Vorschulkind felsenfest behauptet, schon immer über ein bestimmtes Wissen verfügt zu haben, obwohl es dieses Wissen gerade erst erworben hat. Gleichzeitig ändern Kinder ihre Meinung jedoch verhältnismäßig schnell und sind meist recht leicht vom Gegenteil zu überzeugen. Wie passt das zusammen? / mehr